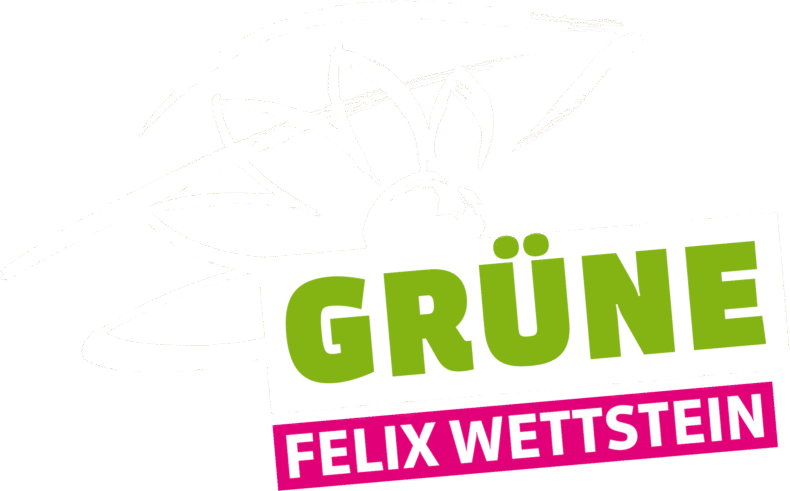Gesundheitsversorgung: Prämienlast macht Sorge
Die stetig steigenden Krankenkassenprämien bereiten vielen Menschen Sorge. Mir auch. «Da muss die Politik etwas dagegen tun» höre ich oft und pflichte bei. «Warum tut die Politik nichts dagegen?» bekomme ich manchmal vorwurfsvoll zu hören. Da muss ich widersprechen: «Die Politik» tut viel. Sie hat damit zum Teil auch Erfolg, zum Beispiel bei der Senkung der Medikamentenpreise oder bei der Verschiebung hin zu ambulanter Behandlung. Die relative Reduktion der Kosten (andere reden von «sparen»: Mir gefällt dieses Wort bzw. diese Wortverwendung nicht) ist allerdings geringer als jene Mechanismen, die zum weiteren Anstieg von Kosten führen. Dazu weiter unten.
Leider werden Kosten und Prämien in dieser Diskussion oft verwechselt. Mit den Prämien der obligatorischen Krankenversicherung finanzieren wir zur Zeit rund 40 Prozent der Kosten des gesamten Behandlungswesens (Quelle: Obsan-2024-OKP-Kosten). Der Rest ist entweder steuerfinanziert, oder es sind Selbstzahlungsanteile (21,6 %, so hoch wie kaum in einem anderen Land! Quelle : BFS 2024, Zahlen von 2022), oder mit Privatversicherungen gedeckt (6,3%) oder via andere Sozialversicherungen. Mehr zum Thema hier: BFS-Statistiken-Gesundheit-Kosten-Finanzierung.
Allerdings, und das ist aus meiner Sicht echter Grund zur Sorge: Anteilmässig ist in den letzten Jahren der prämienfinanzierte Teil stärker gestiegen als die Gesamtkosten. Der Hauptgrund: zunehmend wird ambulant behandelt, wo früher Spitalaufenthalte nötig waren. Im Nov. 2024 ist EFAS (einheitliche Finanzierung ambulant-stationär) angenommen worden: Mit der Umsetzung ab 2026 wird es diese Schräglage nicht mehr geben.
Warum steigen die Kosten eigentlich derart?
Dafür gibt es drei landläufige Erklärungen. Zwei davon sind fachlich widerlegt, eine ist undifferenziert. Die drei Erklärungen lauten: a) die Menschen werden immer älter, b) der medizinische Fortschritt, c) die ständig steigende Anspruchshaltung der Versicherten, sie «rennen wegen jedem Bobo zum Doktor».
- Ja, die Lebenserwartung steigt. Allerdings sind wir deswegen im Durchschnitt nicht länger im Leben krank und behandlungsbedürftig. Statistisch gesehen fallen rund die Hälfte der kassenpflichtigen Leistungen in den letzten beiden Lebensjahren an, egal ob jemand mit 69 oder mit 99 Jahren abtritt.
- Der Fortschritt in Medizin, Pflege, Therapie, Nachsorge und teilweise auch Vorsorge treibt die Kosten an, das ist korrekt. Bloss: Auf welche Art genau, und mit welchen «Begleiterscheinungen», und wohin das Geld fliesst, darüber wird viel zu wenig nachgedacht.
- Der Verdacht, dass die Leute das Behandlungssystem zu vorschnell beanspruchen würde, trifft immer die andern. Ich kenne niemanden, der das von sich selbst bestätigt. Im Gegenteil: Wir setzen meistens, wenn wir krank sind, zuerst auf Selbstheilungskräfte und familiäre Unterstützung. Hinzu kommt, dass Menschen mit tiefem Einkommen manchmal bewusst auf Konsultationen verzichten, weil sie Kosten befürchten (Selbstbehalt, Franchisen, nicht versicherte Leistungen wie z.B. Zahnbehandlungen). Quelle dazu: BFS, Daten von 2022).
Anknüpfend an b) ist also zu fragen: Wer profitiert ökonomisch vom medizinischen Fortschritt oder hofft zumindest, davon zu profitieren? Die generelle Antwort dazu: Nahezu alle, welche das Gesundheitssystem mitgestalten (auch politisch mitgestalten).
Es gibt nach meiner Beobachtung im Gesundheitswesen (präzis: im Krankheitsbehandlungswesen) der Schweiz die folgenden wichtigsten Stakeholder: a) die Pharmaindustrie, vorgelagert die Apotheken; b) die Berufsverbände der «Leistungserbringer»; c) die Institutionen und ihre Verbände; d) die Krankenversicherungen; e) die Kantone; f) die Konsumentinnen, Prämien- und Steuerzahlenden, Patienten.
Die Pharmaindustrie und die Apotheken wollen verdienen. Wenn sie damit Erfolg haben, steigen die Gesamtkosten des Systems. Wenn das bisherige Medikament zwar weiterhin nützt, aber (wegen den behördlichen Preisfestsetzungen) günstiger wird, müssen sie zusätzlich neue Medikamente – meist deutlich teurere – auf den Markt bringen dürfen, und sie müssen die Gesamtmengen erhöhen. Beides tun sie erfolgreich.
Ärztinnen und Ärzte wollen verdienen, Pflegefachleute wollen verdienen, Therapeutinnen und Labormitarbeitende auch. Sie haben anspruchsvolle Berufe, die gut entlöhnt werden sollen: Je nachdem besser als heute. V.a. in der Grundversorgung (Hausärztinnen und -ärzte), Therapie, Pflege, gesundheitsbezogene Sozialarbeit teilen viele diese Bestrebungen nach besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen. Folge: Bei gleich viel Diagnosen steigen die Gesamtkosten. Wohl zurecht.
Die institutionellen Träger wollen verdienen: Spitäler, Gesundheitszentren, Reha-Kliniken, Spitex-Trägerschaften, Labors. Bei den Spitälern sind aktuell 70% defizitär. Es wäre arrogant, sie alle der ökonomischen Unfähigkeit zu bezichtigen. Damit sie überleben können, muss entweder der Kanton einspringen, oder die Pauschaltarife werden erhöht. Beides führt zu höheren Kosten des Systems.
Die Krankenkassen haben ein Interesse daran, dass die Kosten nicht unnötig steigen. Darum stellen sie auch zu Recht die Fragen, ob alle angeordneten Leistungen nötig (= wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich) seien. Die Kassen haben allerdings auch ein weiteres Interesse: Sie wollen Zusatzversicherungen verkaufen und damit Gewinne erzielen. Das gelingt ihnen. Viele der so versicherten zusätzlichen Leistungen bringen nicht unbedingt einen Gesundheitsnutzen im engeren Sinn, aber einen ökonomischen Nutzen für die Institutionen und Berufstätigen. Sie verteuern das Gesamtsystem.
Die Kantone haben eigentlich auch ein Interesse daran, dass die Kosten nicht weiter steigen. Allerdings haben sie weitere Interessen: Wenn sie die Institutionen (v.a. Spitäler) selber führen bzw. an ihnen die Aktien halten, wollen sie, dass diese rentieren. Sie wollen, dass sich die Kantonsbevölkerung im «eigenen» Spital behandeln lässt, und möglichst sollen zusätzlich ausserkantonale Patient:innen kommen. Die Bevölkerung in den Kantonen wehrt sich oft gegen die Reduktion der Spitalkapazitäten.
Es gibt eine weitere Anspruchsgruppe: alle jene Menschen, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten. Sie erwarten vom Gesundheitssystem v.a. dreierlei: Qualität, Transparenz und faire Kosten (vgl. pro-salute.ch). Das erwarten sie nicht bloss dann, wenn sie Patientin oder Patient sind, sondern in ihrem gesamten Leben. «Fair» ist nicht identisch mit billig, sondern der Qualität entsprechend, mit transparenten Preisgestaltungen. Sie erwarten, im Bedarfsfall von qualifizierten Fachpersonen behandelt zu werden.
Was würde die starke Kostensteigerung verhindern?
Die pauschale Antwort liegt auf der Hand: Wenn Pharmaindustrie, Versicherungen, Berufstätige im Gesundheitswesen, Institutionen und Trägerschaften im Versorgungssystem bereit sind, weniger Gewinn zu erzielen bzw. weniger zu verdienen. Anders gesagt: Wenn weniger getan wird: weniger Untersuche, weniger Diagnosen, weniger Eingriffe, weniger Verschreibungen. Oder wenn es zumindest weniger aufwändig gemacht wird.
Wir alle wissen und beobachten, wie schwierig dies ist in einem System, das eben gerade NICHT nachfragegetrieben ist, sondern angebotsgetrieben: Wer Neues, Spektakuläres zu bieten hat, preist dies an (möglichst als alternativlos). Wer mehr abklären, untersuchen, behandeln, verschreiben kann, erzielt mehr Gewinn und eine bessere Auslastung seiner Infrastrukturen.
Die nachfolgenden Möglichkeiten der Kostenreduktionen sind bei weitem nicht abschliessend. Es sind aus meiner Sicht diejenigen mit der grössten Wirkung:
- Geringere Margen. Weil bezahlt wird, was angeordnet und verschrieben wird, werden auch überteuerte Leistungen bezahlt. Kartellartige Strukturen müssen aufgebrochen werden. Hinterzimmer-Preisabsprachen gehören verboten.
- Deutlich weniger Spitalbetten und Spitalstandorte. Zunehmend mehr Eingriffe sind ambulant möglich. Es darf keine Anreize geben, Menschen ohne Not stationär zu beherbergen, damit die Auslastung verbessert wird.
- An Stelle von Spitälern mehr Gesundheitszentren, in denen multiprofessionell am selben Ort zusammengearbeitet wird (auch Beratungsdienstleistungen, nicht nur medizinische). Eingeschlossen sind Ausbildungsplätze. Im Gegenzug weniger Einzelpraxen, die kaum mehr Nachwuchs finden, und weniger ambulante Spezialpraxen.
- Integrierte Versorgung als Normalfall: Erstkonsultation nie bei einer Spezialistin, einem Spezialisten, sondern bei der definierten «Pforte» und (wenn Behandlung länger dauern wird) mit einer Lotsin, einem Lotsen: eine Aufgabe der Sozialen Arbeit.
- Planung der Grundversorgung – stationär und ambulant – in regionalen, oft kantonsübergreifenden Versorgungsregionen (möglichst in funktionalen Regionen, z.B. in den 16 Arbeitsmarkt-Grossregionen.
- Trennung von Grundversicherung und Zusatzversicherungen. Wer für die Grundversicherung zuständig ist, darf nicht auch noch Zusatzversicherungen anbieten.
- Weg von der Ideologie des selbständigen Unternehmers, hin zu Belohnung der hohen Zahl Gesunder. Pro 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner sind eine zu definierte Anzahl Fachpersonen öffentlich angestellt (Medizin, Pflege stationär und ambulant, Sozialarbeit, Therapie etc.). Ist die Population gesund, haben sie bei gleichem Lohn weniger streng und früher Feierabend.
Warum belasten die Kosten die Haushalte zunehmend stärker?
Weil die Gesamtkosten des Systems stärker steigen als die allgemeine Teuerung, und weil wir mit dem schweizerischen System überproportional die einzelnen Haushalte belasten. Diese Haushalte bezahlen die Prämien sowie alle Selbstzahlungsanteile (Franchise, Selbstbehalt, nicht versicherte Leistungen), zusammen über 60% der Gesamtkosten, und in den letzten Jahren überproportional steigend (siehe oben).
Als das Bundesgesetz über die obligatorische Krankenversicherung 1994 eingeführt wurde, war es das Ziel, dass kein Haushalt mehr als 9 Prozent des Einkommens für die obligatorischen Prämien zahlen müsste. Inzwischen kann es sein – je nach Kanton und Haushaltskonstellation – dass trotz Prämienverbilligung bis zu 16% des Einkommens für die obligatorischen Prämien draufgehen. 2024 wurde die Prämien-Entlastung-Initiative abgelehnt, die das Ziel hatte, dass niemand mehr als mit 10 Prozent belastet würde.
Was wäre die Antwort zur Reduktion der Belastung der Haushalte?
Die untaugliche Antwort: Mit einer Reduktion der Gesamtkosten des Systems. Diese Hoffnung wird sich meistens zerschlagen, vgl. vorletztes Kapitel.
Darum muss die taugliche Antwort heissen: Mit einer Änderung des Finanzierungssystems jener Kostenanteile, die über die obligatorische Prämie finanziert werden. Als fast einziges Land der Welt kennt die Schweiz das System der Kopfprämien. Für die tiefsten Einkommen gibt es zwar eine Abfederung in Form der Prämienverbilligungen (PV). Wer jedoch ein Einkommen knapp oberhalb der Grenze hat, die zur PV berechtigt, zahlt genau gleich viel wie ein Einkommensmillionär. Was in der Diskussion immer vergessen geht: Die Bestverdienenden bezahlen gerade mal 1-1,5 Prozent ihrer Einkommen für die Krankenversicherung und bekommen dafür einen umfassenden Service! Das ist im Verhältnis zu jenen Haushalten zu bewerten, die bis zu 16% aufwenden müssen.
Das «Aber» lautet jeweils: «Ja, aber Reiche tragen dank der Steuerprogression mehr mit Steuern zur Finanzierung bei». Das stimmt, allerdings ist der steuerfinanzierte Anteil in der Schweiz relativ gering (weniger als 30% der Gesamtkosten; mit EFAS werden es 26.9% sein).
Die Antwort kann darum nur heissen: Weg von den unsozialen Kopfprämien, hin zu einkommens- und vermögensabhängig gestuften Prämien, siehe Motion 23.3920.
Der Vorschlag ist nicht neu, er wird jedoch bisher im Stände- und im Nationalrat regelmässig von jenen abgelehnt, welche den Privilegierten ihre Privilegien erhalten möchten und den weniger Bevorteilten gerne vorgaukeln, dass sie demnächst zu den Privilegierten gehören werden. Sie haben satte Mehrheiten im Parlament.