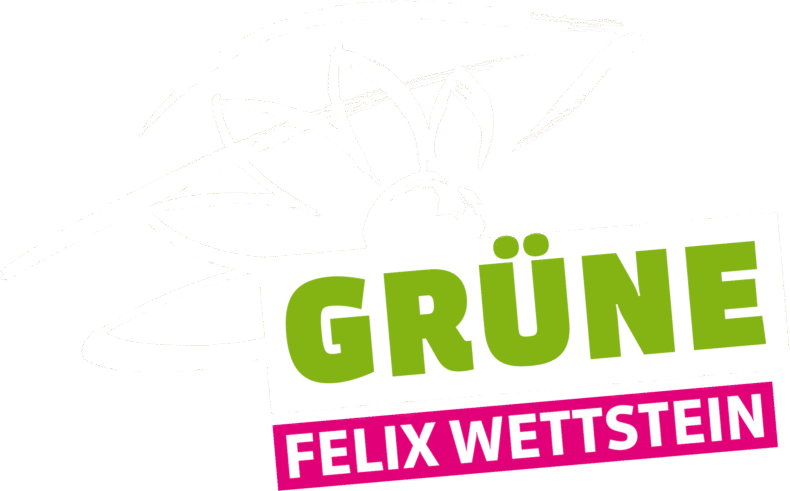Gesundheitsversorgung
Unser Gesundheitswesen ist teuer. Zum einen leisten wir uns zu Recht eine fortschrittliche Versorgung. Zum andern ist gut erforscht, dass rund 20 Prozent aller Eingriffe und Verschreibungen eigentlich unnötig sind und keinen gesundheitlichen Nutzen bringen, manchmal sogar schädlich sind. Darum müssen wir vor allem die Gesundheit fördern statt nur Krankheiten kurieren. Und wir müssen die Finanzierung von Grund auf reformieren.
Grundsätzlich ist zu betonen: Die Schweiz hat in der Gesundheitsversorgung nicht in erster Linie ein Kostenproblem, sondern ein Finanzierungsproblem. Wir setzen rund 12% unseres Bruttoinlandprodukts für die Versorgung bei Krankheit und Unfall ein: Das ist ein ähnlich hoher Anteil wie andere wohlhabende Länder. Wir können uns das leisten. Es gibt auch nicht eine Explosion der Kosten – obwohl es zutrifft, dass sie seit Jahren stärker steigen als die Teuerung.
Was selten beachtet wird: Die Krankenkassenprämien sind in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich stärler gestiegen als die Behandlungskosten insgesamt. Zudem ist bei uns der Anteil Selbstzahlungen (Franchise, Selbstbehalt, ungedeckte Kosten wie Zahnbehandlung) so hoch wie in kaum einem anderen Land. Umgekehrt sind die steuerfinanzierten Anteile anderswo deutlich höher.
Das bisherige System mit den Kopfprämien stösst zunehmend an Grenzen, weil es nur mit wachsenden Geldmengen für die individuelle Prämienverbilligung abgefedert werden kann. Darum ist es dringend, sich von den Kopfprämien zu verabschieden und zu einkommensabhängigen Prämien zu wechseln. Dann braucht es auf einen Schlag keine Prämienverbilligungen mehr, und auch die Ergänzungsleistungen werden stark entlastet.
Weitere Reformen auf Seite der Finanzierung sind notwendig. Ich fordere die Einführung des Verursacherprinzips bei Umwelteinflüssen, die unserer Gesundheit zusetzen und hohe Behandlungskosten verursachen: Pestizide, weitere Chemikalien, aber auch Auswirkungen des Verkehrs (Lärm, Luftbelastung). Auf diesen Produkten soll eine Abgabe erhoben werden, die zur Entlastung der übrigen Finanzierung – namentlich der Prämien – eingesetzt wird.
Weiter sollten wir die obligatorische Grundversicherung und die Zusatzversicherungen organisatorisch trennen. Für die Grundversicherung braucht es nur EINE Gemeinschaftskasse.
Trotz dem Gesagten: Es gibt im Gesundheitssystem diverse überteuerte Lösungen. Darum können wir auch Kosten reduzieren, ohne dass es jemandem gesundheitlich schlechter geht und ohne dass wir Solidarität aufgeben. Aktuell gilt: Wer viel verschreibt und viel behandelt verdient mehr — und die Krankenkassen sowie die Kantone müssen zahlen. Um das zu stoppen, setzte ich mich für verschiedene Massnahmen ein: Was ambulant behandelt werden kann darf nicht zu einem Spitalaufenthalt führen. Bei teuren Operationen soll es Pflicht sein, eine unabhängige Zweitmeinung einzuholen. Bei den Medikamenten müssen wenn immer möglich Generika zum Einsatz kommen. Und die Planung des Spitalangebots muss kantonsübergreifend erfolgen, was umso wichtiger ist, da zunehmend mehr Eingriffe ambulant möglich sind. Wir sollten Spitalkapazitäten reduzieren. Spitzenmedizin braucht es nur an wenigen Orten.